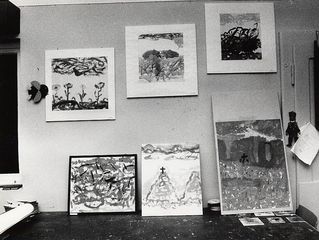Richard Dege war ein besonderer Mann, der ein bemerkenswertes Leben lebte: 1924 kam er in Goslar auf die Welt, hineingeboren in eine schwierige – und zwischen 1933 und 1945 sogar lebensbedrohliche – Zeit. Körperlich erheblich beeinträchtigt, durchlebte er die umfassende Entwicklung des deutschen Hilfesystems des 20. Jahrhunderts am eigenen Leib. Es ist die ungewöhnliche Lebensgeschichte eines Mannes, der stets optimistisch blieb und viel lachte, wie Zeitzeugen berichten. Und der im fortgeschrittenen Alter noch lernte, so gut mit dem Fuß zu malen, dass er zu einer kleinen Berühmtheit wurde.
Im Januar 1932 wurde der damals siebenjährige Richard Dege von seinen Eltern nach Bethel gebracht. Sie erhofften sich, dass ihr Sohn hier seinen Bedürfnissen entsprechend gepflegt und gefördert würde. Denn der Junge litt an einer zerebralen Bewegungsstörung mit Krampfanfällen, verursacht durch eine Hirnschädigung bei der Geburt. Aufgenommen wurde Richard Dege im Haus Patmos, wo er die nächsten zwölf Jahre wohnte.
Inklusion, Partizipation oder sogar persönliche Selbstverwirklichung, die heute Bethels Arbeit kennzeichnen, waren in jener Zeit unbekannte Begriffe. Aber auch damals gab es in Bethel Bestrebungen, die genau diesen Zielen entsprachen. So gaben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter große Mühe, Richard Dege so zu fördern, dass er am Anstaltsleben weitestgehend teilhaben konnte. Dazu gehörte auch, dass er von Beginn an, wie alle Kinder in Bethel, regelmäßig beschult wurde. Während der Jahre des faschistischen Deutschlands und des Zweiten Weltkriegs konnte der Junge, unbehelligt von den Repressalien der Nationalsozialisten, weiterhin in Bethel in seiner gewohnten Umgebung bleiben.
In den Nachkriegsjahren wurde Richard Dege Zeuge einer neuen Entwicklung: Das Bewusstsein für behindertengerechtes Leben stieg, auch wenn sich die damaligen Gegebenheiten noch sehr von den heutigen Möglichkeiten unterschieden. In der Akte von Richard Dege lassen sich einige Hinweise finden, die darauf schließen lassen, wie sehr man an einer „inklusiven Gemeinschaft“ interessiert war. Beispielhaft hierfür steht die Anschaffung eines eigens für ihn angefertigten Schiebefahrstuhls. Dieser Stuhl machte Richard Dege mobiler, und er konnte an Gruppenaktivitäten teilnehmen.